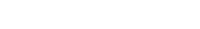Noch bis in die 30er Jahre war in den Bauernhäusern der Eifel vorwiegend irdenes Geschirr in Gebrauch. Porzellan war zwar teilweise in Gebrauch, doch war es in der Anschaffung teuer, und sofern es welches gab, hob man es für hohe Festtage im "Scharf" auf. Irdener Hausrat war dagegen gut erschwinglich und praktisch, weil feuerfest. Händler brachten die Töpferware zumeist ins Haus, wo man es für ein paar Groschen kaufen konnte.
In erster Linie waren es Schüsseln in verschiedenen Größen und Formen, daneben Milchtöpfe, Kaffeekannen, Tassen, Seiher, Teigbüttchen und Kasserollen. Sehr beliebt waren die "Platteln", flache, fast tellerartige Schüsseln, deren Innenseiten mit bunten Ringen verziert waren. Die großen hatten einen Durchmesser von etwa 30 cm und dienten als Kartoffelschüsseln. Bei der Mittags- und Abendmahlzeit stand die "Plattel" hochgefüllt auf dem Tisch. Meist war der Kartoffelhügel mit geschmolzener Butter oder flüssigem Speck ("Grieben") übergossen. Alle Familienmitglieder, Knechte und Mägde aßen aus dieser Schüssel. Waren es der Esser sehr viele, so stellte man zwei Platteln auf den Tisch, um den Vorrat etwas zu verteilen. Dazu gab es Suppe oder Dickmilch, die aus der irdenen Schüssel gelöffelt wurde. Teller wurden bei diesen einfachen Mahlzeiten nicht aufgestellt.
Auch "Heedelich Kneddeln", dem Eifelgericht schlechthin (es besteht aus Heidekorn- oder Buchweizenmehl, Wasser und etwas Salz), wurden aus den Platteln gegessen.
Teigbüttchen nannte man die runden, topfähnlichen Gefäße, in denen die Bäuerin hauptsächlich den Teig für Pfannkuchen, Knödel und Waffeln anrührte. Pfannkuchen gab es häufig, entweder waren sie mit Speck oder Marmelade, seltener mit Hackfleisch bestrichen. In den Stieltöpfen kochte man die Milch, in dem weiten, flachen Seiher ließ man den Klatschkäse ablaufen.
Bei der Kaffeemahlzeit war das irdene Geschirr besonders beliebt. Morgens und nachmittags standen die braunen Kaffeekannen und -tassen auf dem Tisch, nicht immer gleich geformt und gleich groß. Aber die Leute liebten diese Zeit der kurzen Muße und behaupteten, dass der Kaffee aus den "Erdenpöttchen" besser schmecke als aus dem "modernen Porzellan".
Kasserollen waren irdene Töpfe mit Henkeln und Deckeln, die bis zu drei Litern fassten. Darin konnte man Speisen aller Art, vor allem Gemüse, Körner und Suppen, kochen oder erwärmen. Pflaumenmus galt als besonders wohlschmeckend, wenn es in einer Kasserolle gekocht war. Auch Apfelkompott und der berühmte "Birrebunnes", ein Mus aus gebackenen Birnen, wurden darin bereitet.
Jeder bäuerliche Haushalt in der Eifel hatte einen großen bis mittleren Vorrat an irdenem Geschirr. Er stand wohlgeordnet und griffbereit auf einer besonderen Stellage, der "Kannen- oder Schottelbank". Sie fehlte in keiner Bauernküche und ersetzte den Küchenschrank.
Waren Neuanschaffungen an Geschirr nötig, so wartete man auf den Händler, der wenigstens einmal im Jahr vorbeikam. Eifelweit bekannt waren die fahrenden Händler aus Landscheid.
Tonbacköfen standen an mehreren Orten: Raeren, Speicher, Schönecken, Frechen. Hier deckte der Hausierer seinen Bedarf an Töpferwaren, ehe er mit seiner Ware über's Land zog.
Text: Joachim Schröder


 Zurück
Zurück
 Nach oben
Nach oben