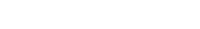Politikunterricht: Rheinland-Pfalz schneidet schlecht ab
"Überraschend kommt das schlechte Ergebnis nicht", urteilt Prof. Dr. Matthias Busch, der an der Universität Trier seit dem Sommersemester 2017 die Professur Didaktik für Gesellschaftswissenschaften bekleidet. Seit Jahren fordert beispielsweise der rheinland-pfälzische Landesverband der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung, der Fachverband der Politiklehrerinnen und -lehrer, eine höhere Stundenzahl für den Politikunterricht. "Mit gerade mal zwei Wochenstunden in der neunten und einer Wochenstunde in der zehnten Klasse erhalten Schüler an rheinland-pfälzischen Gymnasien (G9) nicht nur signifikant wenig politische Bildung. Der Politikunterricht setzt zudem deutlich zu spät ein", so Busch. Andere Bundesländer wie Baden-Württemberg, Hessen oder Nordrhein-Westfalen geben bereits ab dem fünften Jahrgang Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, über Fragen des demokratischen Zusammenlebens nachzudenken.
Schüler wünschen sich mehr politische Bildung
"Viele Schülerinnen und Schüler würden einen höheren Stellenwert der politischen Bildung begrüßen", weiß Busch. So zeigten zahlreiche Befragungen, dass sich Jugendliche einen früheren Beginn und mehr politische Bildung, insbesondere die Thematisierung aktueller politischer Ereignisse, in der Schule wünschten. In den vergangenen 15 Jahren seien das politische Interesse und der Wunsch nach Beteiligung bei Jugendlichen kontinuierlich gestiegen, zugleich aber auch Ressentiments und Distanz gegenüber der etablierten Politik gewachsen. "Politikunterricht – ergänzt um ein partizipativ gestaltetes Schulleben, das demokratisches Erfahrungshandeln ermöglicht – ist deshalb für Jugendliche der wichtigste Ort, um politisch-gesellschaftliche, rechtliche und ökonomische Fragen systematisch zu reflektieren und kontrovers im Klassenverband zu diskutieren."Keine Aussagen über Qualität des Unterrichts
Das "Ranking Politische Bildung 2017" vergleicht bisher allerdings nur Stundenzahlen und Dauer des Politikunterrichts in den Bundesländern. Aussagen über die Qualität des Politikunterrichts lassen sich hieraus nicht gewinnen. Mit dem neuen kompetenzorientierten Lehrplan für die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer hat das Land Rheinland-Pfalz in der Sekundarstufe I in den vergangenen zwei Jahren wichtige Voraussetzungen für die Innovation des Faches geschaffen. Auch die universitäre Lehrerbildung wurde in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahren durch die Schaffung neuer Professuren für die Didaktik der Politischen Bildung an der TU Kaiserslautern und der Universität Trier verbessert.Anforderungen an Lehrkräfte besonders hoch
Nichtsdestotrotz bleibt die Unterrichtsentwicklung in der politischen Bildung eine große Herausforderung. "Die Anforderungen an Fachlehrkräfte sind in der politischen Bildung besonders hoch, da sie gleichermaßen über politikwissenschaftliches, soziologisches, ökonomisches und juristisches Fachwissen verfügen müssen und in ihrem Unterricht ständig wechselnde aktuelle Ereignisse thematisieren", so Julia Frisch, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Arbeitsbereich Didaktik der Gesellschaftswissenschaften an der Universität Trier. "Dass Politikunterricht vielfach fachfremd, also von nicht ausgebildeten Lehrkräften, unterrichtet wird, wie es die Bielefelder Studie andeutet, stimmt deshalb nicht optimistisch."Zu den Personen
Prof. Dr. Matthias Busch unterrichtet seit dem Sommersemester 2017 an der Universität Trier angehende Lehramtsstudierende in Didaktik der Gesellschaftswissenschaften. Zuvor hatte er eine Juniorprofessur für Didaktik der Politischen Bildung an der TU Kaiserslautern inne. Matthias Busch hat selbst Sozialkunde und Deutsch auf Lehramt studiert und war danach zunächst einige Jahre als Dozent und Lehrer an Oberschulen, in der Erwachsenenbildung und der Referendarausbildung tätig. Im November 2017 wurde er für sein Seminar "Politik und Politikvermittlung" mit dem Lehrpreis der Universität Trier geehrt. Im Rahmen des Programms "Sowi4you" bietet sein Lehrstuhl Schulen der Großregion vielfältige Möglichkeiten für Kooperationen, Fortbildungen und Begleitforschung im Bereich der historisch-politischen Bildung an, unter anderem thematische Schüler-Projekttage, didaktische Entwicklungsforschung in Zusammenarbeit von Schulen und universitären Lehrveranstaltungen, Begleitung demokratiepädagogischer Schulentwicklungsprozesse, Bereitstellung von regionalspezifischen Lehr-Lern-Materialien sowie didaktische Fachveranstaltungen für Lehrkräfte.Dr. Julia Frisch ist seit Januar 2018 Mitarbeiterin des Arbeitsbereichs Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften im Fachbereich III der Universität Trier. Sie ist Dozentin in der Geschichts- und Politikdidaktik sowie in den Zusatzzertifikaten für Lehramtsstudierende "Leben und Lernen in der Großregion" und "Lernen und Lehren in der digitalen Gesellschaft". Julia Frisch promovierte an der Universität des Saarlandes zu den interkulturellen Dimensionen grenzüberschreitender Zusammenarbeit von Gewerkschaften. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in der Politikdidaktik, dem transnationalen und interkulturellen Lernen in der Großregion und der Digitalisierung von Schule und Unterricht.
Zu der Studie
Ranking Politische Bildung 2017. Politische Bildung an allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe I im Bundesländervergleich. Hrsg.: Mahir Gökbudak, Reinhold Hedtke. Universität Bielefeld, Didaktik der Sozialwissenschaften, 31.01.2018. RED
Symbolische Last: Wertende Darstellung von Kirche und Judentum im Fokus

Schwerer Verkehrsunfall mit fünf PKW am Krahnenufer




 Nach oben
Nach oben