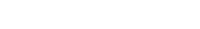Vergessene Heldinnen: Wanderausstellung würdigt Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus
Zugleich war es auch die Auftaktveranstaltung für die Wanderausstellung „Nichts war vergeblich“ – Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Auf Initiative der Gleichstellungsstelle des Landkreises Bernkastel-Wittlich, dem Emil-Frank-Institut Wittlich, sowie des Kulturamtes der Stadt Wittlich und dem Förderverein der Autobahnkirche St. Paul, die diese ausgerichtet haben, wird die Wanderausstellung sechs Wochen lang an verschiedenen Schulen und Orten im
Landkreis zu sehen sein.
Die Erinnerung wach halten
In seinen Eingangsworten zum Gottesdienst erinnerte Wolfram Viertelhaus vom Förderverein daran, dass es angesichts einer erstarkenden und sich verfestigenden rechten Strömung in unserem Land dringend geboten sei, die Erinnerung an die
Gräueltaten des Holocaust wach zu halten. Der Widerstand im Nationalsozialismus war nicht nur geprägt von den bekannten männlichen Widerstandskämpfern, es gehörten ihm eben auch viele Frauen an, derer mit der Ausstellung gedacht werden sollte.
Wanderausstellung zeigt Rolle der Frau als Widerstandskämpferin
René Richtscheid M.A., vom Emil-Frank-Institut Wittlich, führte nach dem Wortgottesdienst in die Ausstellung ein und erläuterte deren Motivation sowie Bedeutung. Nach seiner Kenntnis wurden Frauen in der Gedenkarbeit lange vernachlässigt. Das Bild vom Widerstand war in erster Linie geprägt von der Führung durch Männer. Beschreibungen und Berichte sowie wissenschaftliche Studien waren, wie viele andere geschichtliche Themen, vorwiegend durch den männlichen Blick gesetzt. Frauen spielten in der Betrachtung und in der Bedeutung eine untergeordnete Rolle. Ihnen wurde eher der humanitäre Teil des Widerstandes zugeordnet. Ihre Rolle wurde auch durch das damals gültige Frauenbild marginalisiert.
Dass dieses Bild nicht stimmig ist und einen bedeutenden Teil des Widerstands auslässt, will die Wanderausstellung aufzeigen. Dieter Burgard begrüßte danach Dr. Lena Haase von der Universität Trier, die in ihrem Vortrag die Bedeutung von Frauen in ihrer Rolle als aktive Widerstandskämpferinnen an konkreten Beispielen verdeutlichte.
Sie stellte ebenso wie René Richtscheid fest, dass der Widerstand von Frauen bis in die 2000er Jahre wissenschaftlich wenig in den Blick genommen wurde. Erst durch einen gemeinsamen Antrag der Regierungsfraktionen von CDU und SPD im Jahre 2019 änderte sich diese Sicht- und Denkweise allmählich. In dem Antrag anerkennt und würdigt der Deutsche Bundestag die Leistungen sowie den Mut der Frauen im Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur und fordert unter anderem, die Bedeutung von Frauen im Widerstand stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und verstärkt Veranstaltungen und Ausstellungen hierzu zu fördern.
Am Beispiel einer aktiven Kommunistin aus Trier zeigte Lena Haase auf, dass Frauen eben nicht nur als Anhängsel ihrer Männer zu sehen, sondern sehr aktiv vor allem in der Kommunikation des Widerstandes tätig waren. Trier war zu dieser Zeit ein wichtiges Kreuz des kommunistischen Widerstandes. Besonders aktiv hervorgetan hatte sich dort eine Frau, die unter dem Decknamen Elli für die Verbreitung von Flugblättern und Schriften zuständig war und mehrfach durch einen V-Mann bei den Strafverfolgungsbehörden sowie der Gestapo verraten wurde. Trotz mehrerer Verhaftungen wurde sie, die in Wirklichkeit Henriette Meulenberg hieß, vor Gericht mit ihren Taten nicht wirklich ernst genommen. Man unterstellte ihr ebenso wie vielen anderen Frauen nur als Mitläuferinnen, motiviert durch ihre Männer zu ihren Taten gekommen zu sein. Sie wurde wohl ins Gefängnis überstellt, aber nicht mit der gleichen Härte bestraft wie die männlichen Mitglieder des Widerstandes. 1937 ist Henriette Meulenberg gestorben. Die näheren Umstände sind nicht weiter bekannt.
2000 Gefangene im ehemaligen Lager Flußbach
Dass dennoch eine Vielzahl von Frauen sich mit zunehmender Kriegsdauer dem Widerstand anschlossen, zeigte Frau Dr. Haase am Beispiel des ehemaligen Lagers in Flussbach, wenige Kilometer von Wittlich entfernt. Es wurde ursprünglich 1939 für die Unterbringung von Arbeitern des Autobahnbaus errichtet, diente ab 1941 als Straflager für verurteilte Frauen aus ganz Deutschland und den besetzten Nachbarländern. Waren es am Anfang 18 Frauen, die dort hingebracht wurden und der Strafanstalt Wittlich unterstellt waren, so wuchs die Zahl in den Jahren 1942 - 1944 auf rund 2000 Gefangene an. Mitte 1944 war Flussbach das Hauptstraflager für Frauen aus Luxemburg und Frankreich. Sie waren in der näheren Umgebung zum Arbeiten in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Ende 1944 wurden wegen der heranrückenden Front die Häftlinge weiter in das innere Reichsgebiet verlagert. Viele Hilfsaufseherinnen kündigten ihren Dienst, weil sie mit den Verhältnissen nicht mehr zurechtkamen.
Die aufgezeigten Beispiele aus Trier und Flussbach zeigen deutlich, dass Frauen einen ebenso großen Anteil am aktiven Widerstand hatten. Dies in den Fokus zu nehmen, ist daher eines der zentralen Anliegen der Wanderausstellung.
Sonja Gottlieb sang zur musikalischen Umrahmung der Veranstaltung Lieder von Ilse Weber, die in Theresienstadt gestorben ist, sowie von Konstantin Wecker und Ina Deter.
Michael Wagner
SPD Neujahrsempfang im Eifelkreis

Naturerlebnis pur: Neue Wanderwege in Bernkastel-Kues






 Zurück
Zurück
 Nach oben
Nach oben