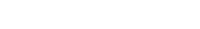Die Scham muss die Seite wechseln - Kolumne
Avignon. In den schmalen Gassen der südfranzösischen Stadt, umgeben von den sanften Farben der Provence, liegt ein Gerichtsgebäude, das zum Schauplatz einer erschütternden Geschichte geworden ist. Eine Geschichte, die nicht nur Frankreich, sondern die Welt in ihren Grundfesten erschüttert hat. Der Name Gisèle Pelicot, eine 72-jährige Frau, deren Lebensweg von Grausamkeit und Mut gleichermaßen geprägt wurde, steht nun für eine Bewegung, die lauter nicht sein könnte: "Die Scham muss die Seite wechseln."
Gisèle Pelicot, geboren in Villingen im deutschen Schwarzwald, lebte über ein Jahrzehnt in einem Martyrium, das an Grausamkeit kaum zu überbieten ist. Ihr Ehemann, Dominique Pelicot, betäubte sie systematisch und bot sie anderen Männern zur Vergewaltigung an. Eine schier unvorstellbare Abfolge von Missbrauch und Verrat, ausgeführt von jemandem, der ihr einst versprochen hatte, sie zu lieben und zu schützen. Die Enthüllungen dieses Falles, der nun vor Gericht verhandelt wurde, brachten eine Lawine des Entsetzens ins Rollen. Dominique Pelicot wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt, die 50 weiteren Angeklagten erhielten Strafen zwischen drei und 15 Jahren. Es sind Urteile, die Gerechtigkeit fordern sollen, aber auch Fragen aufwerfen: Wie konnte ein solches Verbrechen über so lange Zeit unentdeckt bleiben? Warum versagte die Gesellschaft in ihrem Schutz?
Die Wurzel der Scham
Gewalt gegen Frauen bleibt oft unsichtbar - versteckt hinter verschlossenen Türen, unter einem Mantel der Scham, der den Opfern aufgebürdet wird, während die Täter geschützt werden. Gisèle Pelicots Geschichte ist kein Einzelfall, sondern Teil einer endlosen Reihe von Tragödien, über die viele schweigen. "Warum hast du dich nicht gewehrt?" - "Warum hast du nichts gesagt?" Solche Fragen sind keine Suche nach Wahrheit, sondern Werkzeuge der Schuldumkehr. "Die Scham muss die Seite wechseln", erklärte Pelicot nach dem Urteil - ein Satz, der weltweit Widerhall findet.
Ein globaler Aufschrei
Die Resonanz auf den Fall ist enorm. Vor dem Gericht in Avignon riefen Demonstrantinnen "Je suis Gisèle". In Städten weltweit fordern Frauen das Ende der systematischen Gewalt. Was Pelicot erlebte, ist kein Einzelschicksal, sondern Symptom eines Systems, das Täter schützt und Opfer zum Schweigen bringt. Laut einer UN-Studie aus dem Jahr 2023 erlebt über ein Drittel aller Frauen körperliche oder sexuelle Gewalt. Doch die Mechanismen dahinter - fehlende Unterstützung für Opfer, kulturelle Normen, die Gewalt verharmlosen - sind tief verwurzelt.
Hoffnung und Veränderung
Doch es gibt Hoffnung: Pelicots Fall hat ein langes Schweigen gebrochen. Frauen erzählen ihre Geschichten, fordern Wandel und verweigern sich der Scham. "Merci, Gisèle", sagte eine Demonstrantin, "dass du uns eine Stimme gibst." Die Herausforderung ist enorm. Es braucht nicht nur Justizreformen, sondern auch ein Umdenken. Täter müssen zur Verantwortung gezogen, Opfern Gerechtigkeit und Würde zurückgegeben werden.
Der Fall Pelicot mag aus den Schlagzeilen verschwinden, doch seine Botschaft bleibt: Die Welt darf nicht länger wegsehen. Jede Stimme zählt, um eine Zukunft zu schaffen, in der Frauen ohne Angst leben können. Die Scham muss die Seite wechseln. Ein einfacher Satz - eine radikale Forderung. Und wenn sie Wirklichkeit wird, könnte sie die Welt verändern.




 Zurück
Zurück
 Nach oben
Nach oben